Karnevalsgottesdienst, 08.02.2026, "Nostalgie im Wüstensand auf dem Weg ins neue Land", Mutterhauskirche, Peter Krogull
Büttenreden-Predigt von Pfarrer Peter Krogull: „Nostalgie im Wüstensand auf dem Weg ins neue Land“
Liebe Närrinnen und Narren hier in Kaiserswerth,
dachtet ihr auch im Januar: „Ich glaub, mich tritt ein Pferd?“
Drei Tage war das neue Jahr erst alt,
da hat es in Venezuela schon geknallt.
Maduro wird von Trump gefasst,
das Völkerrecht wird schnell geschasst.
Nun will der Donald Grönland haben,
und sich auch dort an den Rohstoffen laben.
Doch auch in Deutschland spielten manche verrückt:
Besonders die Berliner waren nicht entzückt,
als man ihnen den Strom abstellte,
und sich zur Dunkelheit auch noch die Kälte gesellte.
Da möchte man gar nicht mehr die Nachrichten sehen.
Wer kann denn noch diese Gegenwart verstehen?
Da schaue auch ich lieber in die Vergangenheit zurück
und suche in meinen Erinnerungen das Glück.
Schön war die Zeit, als Düsseldorf war schuldenfrei,
als die Fortuna spielte nicht in Liga Zwei.
Schlittschuh konnte man im Winter draußen laufen
und sich für eine D-Mark drei Eiskugeln kaufen!
Deshalb kann ich mich gut in die Israeliten hineinversetzen,
als sie nach dem Schilfmeer durch die Wüste hetzen
und sie auf einmal die Sehnsucht übermannt
nach dem alten Sklavenhaus Ägyptenland.
„So schlimm war es damals doch gar nicht dort.
Wenigstens gab es etwas zu essen an diesem Ort!
Besser unfrei und ein armer Knecht,
als vogelfrei und vor Hunger geschwächt!“
Ihrem Befreier wollten die Israeliten an den Kragen.
„Mose, wie konntest du es denn nur wagen
uns aus der Sicherheit zu führen?
Ach, wären wir doch wieder hinter Gefängnistüren!“
Wisst ihr, wie man diese Denke nennt?
Die sich nach der Vergangenheit sehnt und darüber die Gegenwart verpennt?
Der Name dieser Einstellung ist Nostalgie.
Warum sie so verbreitet ist? Nun, hier kommt meine Theorie:
Die Erinnerung des Menschen ist manchmal wie ein Sieb.
Was schön war und was gut war und was lieb,
das bleibt drinhängen und das prägt sich uns ein.
An das Schlechte und das Schwierige erinnert sich oft kein Schwein.
Das Negative sickert durch, das Unschöne wird verdrängt,
Denn im Oberstübchen ist es oft ziemlich beengt.
So färbt sich die Vergangenheit rosarot,
Was dazu nicht passt, bekommt Aufenthaltsverbot.
Auch die Israeliten litten unter diesem Gedächtnisverlust.
Denn in der Wüste gab es ja nicht nur Frust.
Gott schenkte ihnen Manna und auch Wachteln.
An jedem Tag hatten sie da etwas zu spachteln!
Doch gottvergessen wie sie waren,
sehnten sie sich nach bleibenden Waren.
Das tägliche, himmlische Gottesbrot
war nur der Stopfen in der Not.
Doch will ich nicht nur auf den alten Israeliten herumhacken.
Wir heutzutage haben doch auch unsere Macken!
Kollegin Heimann sprach schon den Wohlstand an.
Und ich nehme jetzt unsere Kirche dran.
Denn auch in der Gemeinde Jesu, unseres Herrn,
da hat man die Nostalgie gar schrecklich gern.
Da sehnt man sich auch nach der guten alten Zeit zurück
und verliert dabei das Positive der Gegenwart aus dem Blick.
Ein Beispiel gefällig? Gerne, kommt sofort:
Ich denke hier an diesen Ort:
„Was sind die Gotteshäuser heutzutage leer!“
Sehr oft höre ich diese alte Mär!
Dabei sind die Kirchen oft gut besucht,
wenn man mal etwas Neues versucht.
Und außerdem ist dieses Lamentieren ein alter Hut.
Schon im 18. Jahrhundert kannte man dieses Jammern gut!
Im Gesangbuch findet sich von 1711 ein Lied.
Wisst ihr, was damals ein Pastor schrieb?
„Man höret immer Deine Klage, dass Dein Haus nicht will werden voll.“
Früher war also nicht alles besser. Manche Probleme sind richtig oll!
Ganz in diesem Sinne hat Guido Mingels ein Buch geschrieben,
um das Hier und Heute mehr zu lieben.
„Früher war alles schlechter“ ist der Titel von seinem Band.
Damit die Nostalgie hält endlich mal den Rand!
Mingels erzählt da ganz faktenbasiert,
worin die Gegenwart über die Vergangenheit triumphiert.
Zum Beispiel beim Thema Kindersterblichkeit.
Viel verbreiteter war früher dieses Leid.
Und das Leben der Kinder war früher auch kein Zuckerschlecken.
Kinderarbeit und Analphabetismus in Deutschland an allen Ecken.
In solche Zeiten träumt sich wohl niemand zurück.
Heute zu leben ist manchmal ein Glück.
Und das ist auch in der Kirche so.
Über manche Veränderungen bin ich richtig froh!
Denken wir nur an den Bund fürs Leben!
Früher hat es da viele konfessionelle Probleme gegeben!
Wenn sie war katholisch und er Protestant,
wurde man manchmal dafür fast verbannt!
Zum Glück herrscht bei diesen Unterschieden
heutzutage meistens Frieden.
Dass früher nicht alles besser war,
mache man sich an der Ökumene klar.
In ganz vielen Seelsorgebereichen
kann man uns nur noch ökumenisch erreichen!
Am Telefon oder in der Notfallsituation:
Wen interessiert die Konfession da schon?
Noch viel mehr können die Kirchen da zusammenwachsen
und aufhören mit den trennenden Faxen!
Auf diesem Weg ist ein richtig guter Schritt,
der Rosemontagszug. Bei dem machen nicht nur die Kirchen mit!
Viele Religionen sind beim Toleranzwagen an Bord!
Nicht alle praisen unseren Lord.
Hauptsache sie stehen für die gemeinsamen Sachen ein:
Tolerant sein und Kamelle werfen. So muss es sein!
Der Toleranzwagen tut es allen kund:
Ejal wat kütt – Mer bliewe bunt!
Ejal, ob der Putin will unseren Wagenbauer verklagen,
Niemand geht unserer Meinungsfreiheit an den Kragen!
Ejal, ob die Rechten sehnen sich nach Remigration.
Dass da nichts Gutes rauskommt, lehrt uns die Geschichte schon.
Einander lieben und nicht hassen.
Niemanden verteufeln, Vorurteile lassen.
Klarer als Jesus kann man es nicht sagen.
In eine gute Zukunft fahren wir auf seinem Wagen.
Bei Jesus sind alle Menschen willkommen,
die frechen und die superfrommen,
egal ob Mann oder Trans oder Frau,
egal ob du Alaaf schreist oder Helau!
Jesus liebt seine Gemeinde bunt.
So halte ich nun meinen Mund.
Und sage zum Ende nur noch ein Wort:
Natürlich „Amen“, immer passend an diesem Ort.
Wobei an Karneval wäre es auch ganz schlau,
am Ende gemeinsam zu rufen: Kaiserswerth: Helau!
Mutterhauskirche Helau!
Düsseldorf Helau!
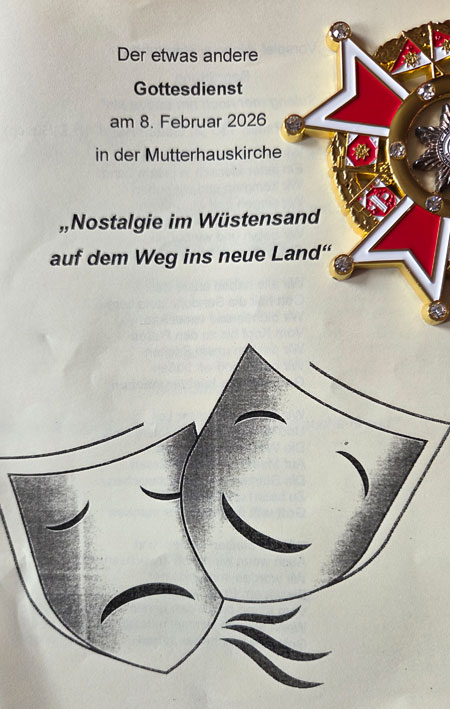 |
 |
 |
 |
 |
letzt.S.n.Epiphanias, 01.02.2026, Offb 1, 9-18, Tersteegenkirche, Doerthe Brandner
Bange machen gilt nicht!
Sicher kennen Sie diesen Ausspruch, liebe Gemeinde.
Er stammt von dem Philosophen Theodor W. Adorno, dem aufgrund seiner halbjüdischen Abstammung 1933 von den Nazis die Lehrerlaubnis in Frankfurt entzogen wurde. Nach seiner Rückkehr aus seinem US-amerikanischen Exil nach Deutschland beeinflussten seine Gedanken seit der Nachkriegszeit bis in die Zeit der Studierendenrevolten Ende der 60er Jahre sowohl die wissenschaftliche Philosophie wie auch die lebensnahe und alltagstaugliche philosophische Sicht auf das Leben wesentlich. Und so sagt er:
Bange machen gilt nicht!
Wer das sagt, ruft all den Angstmachern der Zeit zu:
Unfair seid ihr!
Lasst das sein!
Wir lassen uns von euch nicht einschüchtern!
Nein, bange machen gilt nicht!
Bange machen ist kein angemessenes Instrument – weder für alles Zwischenmenschliche noch für das Handeln und Agieren auf den großen Bühnen der Welt in Politik und Wirtschaft.
Mark Carney, der kanadische Premierminister, hat dazu in seiner Rede in Davos klare Worte gefunden und viel Achtung dafür erfahren.
Wie wichtig sind doch Menschen, die sich nicht Bange machen lassen!
Damals z. Zt. des Nationalsozialismus.
Damals in der Zeit der noch jungen Bundesrepublik.
Damals zu jedem Damals unserer Zeit- und Weltgeschichte.
Und heute!
Immer – und eben auch heute – gibt es so viel, das Bange macht, Angst weckt, Furcht schürt… und so viele, die das Bangemachen als Instrument ihres politischen Handelns nutzen…
Da gibt es die prominenten Namen des aktuellen Weltgeschehens in Ost und West, Nord und Süd:
- Das Bangemachen wird geübt durch gewaltsam agierende Behörden wie der größten Polizei- und Zollbehörde des Ministeriums für Innere Sicherheit in den USA – ICE;
- Es wird praktiziert durch spektakuläre Prozesse wie den gegen den Düsseldorfer Karnevalswagenbauer Jacques Tilly in Russland;
- Es wird auf die Spitze getrieben in willkürlichem Morden von Demonstrierenden und darauf folgenden Repressalien den Angehörigen der Ermordeten gegenüber, die die Körper ihrer Lieben einfach nur in Würde bestatten wollen im Iran.
Und das sind nur 3 im Moment prominente Beispiele für das Bangemachen, das gerade in unserer Welt herrscht.
Da gibt es auch das Bangemachen bei uns durch eine unsensible oder sogar bewusst eingesetzte Sprache:
- Flüchtlingsschwemme z. Bsp. – als ob Menschen eine Schwemme sein könnten
- „Migrationsproblem“ als wäre die Tatsache, dass Menschen aus welcher Not auch immer die Verursachenden für unsere Probleme seien und nicht das Problem darin besteht, dass Menschen überhaupt ihre Heimat verlassen müssen
- Oder eine Rede wie die vom „Stadtbild“, die nicht dazu beiträgt, dass die gesellschaftliche Situation differenziert wahrgenommen wird.
Bange machen ist ein gesellschaftlich-politisches Instrument geworden – von den einen bewusst und gezielt eingesetzt, von anderen unreflektiert daher gesagt oder nachgeplappert.
Und – auch ohne ein besonderes historisches Wissen zu haben – vermute ich, dass bange machen schon immer ein bevorzugtes Instrument von Machthabenden war.
Zumindest scheint dem Autor des Predigttextes von heute ebenfalls ordentlich Bange gewesen zu sein.
In der südlichen Ägäis, auf der griechische Insel Patmos treffen wir diesen Schreiber, den wir als Johannes den Seher durch das letzte Buch unserer Bibel, der Offenbarung – oder Apokalypse, wie es mit dem griechischen Namen heißt, kennen, liebe Schwestern und Brüder.
Weder treffen wir ihn durch ein idyllisches Fischerdörfchen spazierend, noch mit einem kühlen Getränk am Traumstrand liegend, sondern offenbar ist er dort gestrandet – vielleicht sogar unfreiwillig dort.
- Denn wirklich gut scheint es ihm nicht zu gehen.
Ich, Johannes, euer Bruder in der Bedrängnis, schreibe euch. – So stellt er sich seinen Leserinnen und Lesern vor.
Bedrängnis, das ist irgendwie ein zahmer Ausdruck für seine – wahrscheinliche – Situation der Verfolgung um seines Glaubens Willen mit drohender Todesstrafe für ihn und für alle, deren Namen und Orte er Gefahr läuft, unter der Folter zu verraten.
Ja, Johannes ist wohl mächtig bange um seinen eigenen Leib und sein Leben. Und er ist bange um den Zustand seiner Welt. 150 n. Chr. war das römische Reich auf einem seiner Höhepunkte der Macht und Größe und drohte zu kippen. Die politische Reaktion war Demonstration von Macht und Säbelrasseln nach außen und Verstärkung der Restriktionen nach innen.
Und das kommt mir doch sehr bekannt vor, denke ich an die Personen, die ich eben erwähnt habe und an die Schlagzeilen, die wir täglich lesen.
Johannes also auf der kleinen Insel Patmos, setzt sich hin und schreibt an die sieben Gemeinden, mit denen die ganze damalige christliche Welt beschrieben ist.
Und wir heute hier in Tersteegen hören seine Worte. Wir heute hier in Tersteegen, die wir ein Teil der heutigen christlichen Welt sind.
Und was er schreibt – bzw. besser WOVON er schreibt, hat selber wieder die Qualität, einem wirklich Bange zu machen. Es ist eine Gottesbegegnung der ganz anderen Art – eine, die wohl niemand von uns selber gerne haben würde.
Hören wir also, was Johannes, der letzte Prophet von dem unsere Bibel berichtet, in Offb 1, 9-18 schreibt:
9 Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse
an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus,
war auf der Insel, die Patmos heißt,
um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen.
10 Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn
und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune,
11 die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch
und sende es an die sieben Gemeinden:
nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira
und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea.
12 Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete.
Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter
13 und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand
und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel.
14 Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle,
wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme
15 und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet,
und seine Stimme wie großes Wasserrauschen;
16 und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand,
und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert,
und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht.
17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot;
und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach:
Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte
18 und der Lebendige. Ich war tot, und siehe,
*ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit
und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.
- Er, Johannes, unser Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus (…)
Schreibt und nimmt uns schreibend mit hinein in die Begegnung einer angsteinflößenden Gestalt.
Wie die Mächtigen seiner Zeit – die, die die übrigen Menschen in Furcht und Schrecken versetzen, ist diese Gestalt gekleidet:
Ihr langer Mantel, der über der Brust gegürtet ist, erinnert an die Kleidung von Hohenpriestern und Herrschern.
Menschen-ähnlich ist sie. Und zugleich trägt sie die göttlichen Zeichen, die lange vor ihr auch andere Propheten wie der Prophet Daniel gesehen haben:
Blendendes Licht um die Gestalt herum, wie Feuerflammen sind die Augen, ihre Füße wie strahlendes Golderz… und in der Hand hält dieser Menschen-Ähnliche sieben Sterne.
Alle Macht des Himmels und der Erde und der Unterwelt sind dieser Gestalt in den Leib geschrieben. ALLES liegt innerhalb seines Machtbereichs. Das zwei-schneidige Schwert, das aus dem Mund dieser Gestalt herauskommt, symbolisiert das unanfechtbare Machtwort und Gericht. Es lässt begreifen, dass, wer dieser Gestalt – wer Gott in dieser Gestalt – begegnet, nichts mehr wird verbergen können und seinem Urteil – ebenso gnadenlos ausgeliefert ist, wie es damals Johannes den Mächtigen war und wie es heute viele in etlichen Ländern ebenso sind.
Schaue ich aber von Ferne auf diese Gotteserscheinung – so, als ginge sie mich PERSÖNLICH gar nichts an, ertappe ich mich bei dem Gedanken:
Ja, so einen Gott bräuchten wir!
Gott als einen, der all den furchtbaren Herrschern unserer Welt im Osten, im Westen an allen Orten mit demselben Machtgebaren gegenübertritt, mit der sie versuchen die ihnen anvertrauten Menschen klein und untertänig zu halten.
So ein Gott würde ihnen mit ihren eigenen Mitteln ordentlich Bange machen – einfach, weil er der Stärkere ist.
Ehrlich, liebe Schwestern und Brüder – manchmal, manchmal fände ich das einfach nur gut!
Allen anderen aber – denen, die in Bedrängnis sind – wie Johannes der Seher es ausdrückt – allen anderen soll Gott aber doch bitte BITTE! als der sanfte Heiler Jesus begegnen, als die tröstende Mutter, der barmherzige Vater… Und uns – für uns – soll er doch bitte auch der „liebe Gott“ sein, der „gute Gott“, wie er so häufig in gottesdienstlichen Gebeten genannt wird – der uns wie eine Adlermutter auf ihren Schwingen trägt.
Schön wär’s!
Nehme ich diesen Predigttext für heute aber ernst, dann sehe ich keine andere Möglichkeit, als dieser furchteinflößenden Gotteserscheinung wie Johannes wirklich zu begegnen…
Und Gott wie Johannes zu sehen – oder doch wenigstens den Gedanken an Gott zuzulassen als an einen, der einem – wiederum wie Johannes – mächtig Bange machen kann.
Und Johannes, dem sowieso schon angst war, ist nicht der erste und nicht der Einzige, der Gott in seiner Größe und Macht erfährt. Erst vorhin haben wir in der Lesung von Mose am brennenden Dornbusch gehört, der sein Gesicht verhüllt, weil er sich fürchtet, Gott anzuschauen.
In unserem Predigttext fällt Johannes wie tot zu Boden.
Begegnung mit Gott, die größer ist als eine Erfahrung der Gottesnähe, die wohltuend ist – auch die gibt es und das ist gut so! – Begegnung mit der Unfassbarkeit Gottes bedeutet also wohl immer Erschrecken,
wirft in eine tiefgreifende Erschütterung
und führt in die durchaus Bange machende Erkenntnis,
dass Gott so viel mehr ist als Güte und Gnade – so großartig diese auch sind – und dass Gott un-be-greifbar ist,
mysteriös,
nicht einpassbar in keines unserer Gottesbilder und -vorstellungen,
sondern ein Geheimnis, das es immer wieder neu zu suchen und sich ihm anzunähern gilt:
Deshalb ist der Name, mit dem Gott sich Mose zeigt, kein: So bin ich! sondern ein schwebendes, sich immer wieder neu entfaltendes: Ich werde dasein, als der ich dasein werde.
Als der ich dasein werde… – für Johannes, der ja schon wie tot am Boden liegt, in Schreckstarre vor dieser un-sagbaren Gestalt kommt es noch schlimmer.
Denn diese Bange machende und Angst einflößende Gestalt kommt noch näher.
Handgreiflich wird sie.
Die Hand legt diese machvolle Gottheit auf Johannes.
Und Bilder aus Fantasiefilmen steigen in mir auf: Bilder, wie ein Mensch durch die Berührung eines fremden Machtwesens in den Bann dieses Wesens gezogen wird, das eigene Selbst verliert… – oder gleich ganz und gar getötet wird. Die Dementoren bei Harry Potter sind z. Bsp. solche Wesen.
Doch hier – in der Berührung des Menschen-Ähnlichen und zugleich so erschreckenden Herrschers fallen plötzlich Gottes erschreckend-erschütternde All-Macht und seine unbedingte Nähe und Gott-Verbundenheit mit dem Menschen in eins.
Und in der Berührung öffnet sich für Johannes das Erkennen:
In dem Unbegreiflichen zu Tode Erschreckenden wird der auferstandene Christus spürbar, der bis zu seinem Tod alle Menschenwege gegangen ist, die ein Mensch nur gehen kann. Darin ist der unbegreifliche Gott uns, seinen Menschen, nah gekommen.
Liebe Schwestern und Brüder,
haben Sie schon einmal erlebt, dass Ihnen jemand bei Sprechen unwillkürlich die Hand auf den Arm legte? – Oder haben Sie diese Geste selber schon einmal – vielleicht ebenfalls unwillkürlich gemacht, als Sie jemanden etwas besonders Wichtiges mitteilen wollten?
Kennen Sie es, dass Ihnen schon mal jemand die Hand in den Rücken gelegt hat – zwischen die Schulterblätter vielleicht – und Sie gespürt haben, wie Ihre Steh-Kraft stabiler wurde?
Können Sie sich vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn jemand behutsam seine Hand auf Ihre Brust oder Ihren Bauch legt – manchmal macht man diese Geste auch bei sich selber – und die Berührung lässt Sie Ihren Atem wieder spüren und öffnet Sie wieder für die Lebenskraft?
– So, irgendwie, stelle ich mir die Geste dieser Gotteserscheinung vor, sodass aus der Bange machende Gestalt einer wird, den man hören kann – nicht wie mit einer Stimme wie Posaunenklang, von der Johannes zuerst schreibt, sondern als Menschenstimme in Gottes Stimme, die sagt:
Fürchte dich nicht!
Kein Bangemachen von irgendwem oder irgendetwas gilt mehr.
Bange machen gilt nicht mehr!
Das kann nur einer sagen, der selber weiß, wie sich Angst anfühlt und der durch die Angst hindurch gegangen ist
Denn ich war tot und siehe ich bin lebendig
und der deshalb WEISS: Es gibt etwas, das jede Angst umfasst und übersteigt.
Und dieses „Etwas“ – ich nenne es TROTZKRAFT und HOFFNUNG – umfasst Anfang und Ende und alles dazwischen auch. Es umfasst Leben und Tod.
Ich halte die Schlüssel des Todes und aller Unterwelten
und Abgründe der Welt in meiner Hand.
- Das sagt die Christusgestalt
Und das gilt IMMER – Jetzt und jedes Jetzt und ohne Ende.
Und ich erhasche – mit Johannes – ein Verstehen:
Gott in Christus ist so viel mehr als der liberale, manchmal regelrecht weichgespülte Jesus unserer Predigten. Er ist so macht- und kraftvoll, dass es uns vor Erschrecken zu Boden gehen lassen kann.
UND er ist darin nicht grausig, wie es das Bild dieser Vision Schreck-hervorrufend malt.
Seine Macht ist die des Herrn über Leben und Tod – nicht mehr und nicht weniger. Denn er selber hat Leben und Tod so durchlebt und durchlitten, dass wir – jeder Mensch – darin wir mit unserem Leben und Tod umfasst sind.
In diesem Mensch-Gott Christus vereinen sich die ganze Schönheit, die vollkommene Zartheit, Sanftheit und Liebe und die tiefe Weltendunkelheit und die ganze Abgründigkeit unseres menschlichen Daseins. – Der Lebens- Sterbens- und Auferstehungsweg Jesu zeugt davon.
Und wenn wir in besonderen, seltenen Momenten unseres Glaubens davon etwas erkennen, erschreckt es uns und erschüttert uns tief.
Und zugleich öffnet es unser Verstehen, dass das von diesem Christus gesprochene: Fürchte dich nicht! nicht nur Zuspruch und Trost ist, der die Angst besänftigt, sondern vor allem Zuspruch der Kraft, die nötig ist, um den Mächten und Mächtigen unserer Tage zu trotzen.
Denn durch Mose am Dornbusch und mit Johannes, dem Seher wissen wir ja, dass Gott in all seiner Unverfügbarkeit für uns doch IMMER da ist– und sich in jedem Augenblick als der erweist, der er ist.
Und er gibt uns, was wir benötigen nicht im Voraus – vorhin haben wir das gemeinsam mit dem Glaubensbekenntnis von D. Bonhoeffer bekannt – sondern immer dann, wenn wir es brauchen –
Damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen.
Mit der Kraft dieses Gottes, der der: Immer-da und immer wieder neu und nie gleich ist, müsste all unsere Angst vor der Zukunft überwunden sein.
Manchmal, liebe Gemeinde,
macht uns das Weltgeschehen Angst.
Und manche Sorge über den guten Ausgang unserer Welt ist berechtigt.
Doch sich deshalb Bange machen zu lassen, gilt dennoch nicht.
Denn wir gehen durch unsere Zeit mit dem großen Gotteszuruf: Fürchte dich nicht.
Mit ihm begegnen wir unserer Zeit mit der Trotzkraft Hoffnung.
Denn der, der unsere Zeit ins Sein rief, der hält sie umfasst und der vollendet sie auch – bis uns wie dem Seher Johannes nach seinem langen Weg durch die erschreckenden Visionen von dieser Welt dieses Welt-Sehen vergeht, weil wir erneut hören, wie Gott spricht und er sagt: Siehe ich mache alles neu.
Und so, liebe Schwestern und Brüder,
sehe ich unsere vordringliche Aufgabe als Christenmenschen heute darin, im Glauben an das Neue, das als Gottes Reich schon da und mitten unter uns ist,
uns nicht Bange machen zu lassen, sondern uns allen angstverbreitenden Mächtigen und angsteinflößenden Erfahrungen dieser Welt mit dem Trotz der Hoffnung, die in Gott gegründet ist, in Wort und Tat entgegen zu stellen.
Dazu lasst uns von Gott berühren!
Amen
3.S.n.Epiphanias, 25.01.2025, Röm. 12, 17-21, Tersteegenkirche, Jutta Grashof
In der Predigt bezieht sich Pfarrerin i.R. Jutta Grashof auf den Römerbrief von Paulus - und auch auf den Taufspruch des heutigen Täuflings: "Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem“.
Dieser Predigt gibt es als Podcast aus der Tersteegenkirche zum Nachhören, wenn Sie diesem Link folgen.
1.S.n.Epiphanias, 11.01.2026, Offb.21,5 (Jahreslosung) u. Jes.43,18-19, Mutterhauskirche, Ulrike Heimann
Liebe Gemeinde,
die Jahreslosung der Herrnhuter Brüdergemeine für 2026 kann man sich wirklich gut merken: „Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu!“
Bei diesem Satz kann man eigentlich nur aufatmen. Eine großartige Verheißung für 2026: alles wird neu.
Und Gott sorgt dafür. Er macht alles neu.
Da hat Gott sich, so müsste der Schluss sein, ja ordentlich was vorgenommen. Was müsste nicht alles neu werden – auf dieser Erde, in unserer Gesellschaft und Wirtschaft, in unserem beruflichen und privaten Leben. Die vielen Konflikte und Kriege in unseren Tagen, das Flüchtlingselend und die Klimakrise: sie schreien förmlich danach: „Gott, mach alles neu!“ Die Menschheit hat den Wagen an die Wand gefahren. Da ist kein Ausweg zu erkennen. Jetzt bist du dran, Gott. Jetzt musst du es richten.
Liebe Gemeinde, das sind Gedanken, die einem kommen können, wenn man die Jahreslosung hört. Wir erleben unsere Zeit gerade als eher problematisch und wenig zukunftsoffen. Befürchtungen wabern durch die Medien und finden großen Widerhall in den Herzen der Menschen. Und das, obwohl es uns objektiv nach wie vor unverschämt gut geht. Wir haben gerade Weihnachten gefeiert, die Gabentische waren sicher reichlich bestückt und hungern brauchte bestimmt keine/r. Wenn es für uns so bleiben würde, dann wäre ja alles in Ordnung. Aber der Düsseldorfer Norden ist keine Insel, und Deutschland ebenso wenig; auch Europa nicht. Die Welt ist eine. Es ist diese Erkenntnis, aus der die Unruhe wächst, die Furcht vor Verlust unseres recht angenehmen Lebens. Wir können nicht dauerhaft verdrängen, wieviel Ungerechtigkeit und menschenverursachtes Leiden in dieser Welt herrscht, wie viele Menschen um ein Leben in Würde gebracht werden, wie vielen das Nötigste zum Leben fehlt. Ja, nur wer diese Erkenntnis an sich heranlässt, wer sich Mitmenschlichkeit und Empathie bewahrt hat, nur für den ist der Vers aus der Offenbarung eine gute Jahreslosung, eine frohe Botschaft: „Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu.“
Die Gemeinden in Kleinasien, für die Johannes seine Offenbarung schrieb, waren in einer deutlich anderen Situation als wir heute. Sie konnten ihren Glauben nicht öffentlich leben. Christen galten als Staatsfeinde, weil sie nicht am Staatskult teilnahmen. Immer wieder kam es zu Verfolgungen, viele landeten als Zwangsarbeiter in Minen und Steinbrüchen, Frauen und Kinder wurden versklavt und nicht wenige bezahlten ihr Bekenntnis zu Christus mit dem Leben. Die Macht des Imperiums, die Macht Roms schien alle im Würgegriff zu haben. Nicht nur Christen, sondern die Menschen in allen besetzten Ländern und Regionen wurden drangsaliert und unterdrückt. Das muss man wissen, wenn man die Offenbarung liest. Die vielen düsteren Bilder, die Johannes in den ersten 20 Kapiteln beschreibt, sie sind verschlüsselte „Berichte“ von der Not, unter der die einfachen Menschen im Imperium Romanum lebten, Bilder, die bis heute auf ihre Weise durchaus mit der Realität zu tun haben: die vier Reiter sind Hinweise auf Krieg und Bürgerkrieg und – in deren Folge – auf Teuerung, Seuchen und Hungersnot. (Offb.6,1-8) Und es geht auch darum, wie aussichtslos der Widerstand gegen alles Unrecht ist, sodass viele zu Mitläufern werden (13,16-17), die versuchen, für sich etwas herauszuholen, die sich blenden lassen von schönen Worten und Versprechungen, die falschen Propheten nachlaufen. So übermächtig ist die Not, dass nur noch Rettung von Gott herkommen kann. Der Herr der Heerscharen schickt seine Engelheere, denn die Macht des Imperiums ist nach damaliger Vorstellung keine innerweltliche Angelegenheit, sondern hier tobt sich die Hölle auf der Erde aus.
Am Ende fällt Feuer vom Himmel und vernichtet die widergöttlichen Mächte. Gott beendet die Not, die durch die imperiale Macht und ihre Gewaltherrschaft über die Völker gebracht wurde, im Gericht über die Welt und über jeden Menschen – die Lebenden wie die Toten.
„Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen.“ heißt es zu Beginn des 21.Kapitels. „Was früher war, ist vergangen. Und Gott sprach: Siehe, ich mache alles neu!“
Siehe, ich mache alles neu. Ein Satz, der Trost, Mut und Hoffnung spenden will. Aber er steht in einem nicht ungefährlichen Kontext – im Kontext apokalyptischer Untergangserwartung.
Ich sage das besonders mit Blick auf viele evangelikale, bibeltreue Christen und Kirchengemeinden in den USA, die einen enormen Einfluss auf die republikanische Partei haben und damit auch auf die politischen Entscheidungen der Regierung Trump. In ihrem wortwörtlichen Verständnis der biblischen Texte als nicht hinterfragbares Wort Gottes lesen sie gerade die Offenbarung des Johannes als Prophezeiung für die Endzeit, die sie als so nah wie noch nie verstehen. Das entnehmen sie den verschiedenen Schilderungen der Katastrophen, die sich ereignen sollen, bevor es zur alles entscheidenden Schlacht bei Armageddon kommt, in der Gott/Christus/die Guten den Satan/die falschen Propheten/die Bösen besiegen und vernichten werden. Für die Guten und an Christus Glaubenden bricht dann die Ewigkeit auf einer neuen Erde an. Und weil in der Bibel doch auch steht, dass Gott sein Volk zuletzt – also zur Endzeit – in Israel/Jerusalem versammeln wird, bevor dann der Messias, also Jesus Christus zum Endkampf und Gericht erscheint, deshalb unterstützen sie die völkerrechtswidrige Besiedelung und Annektierung palästinensischen Landes durch Israel. Es ist pervers, aber viele hoffen geradezu darauf, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten die Schlacht von Armageddon auslösen. Denn erst dann geschieht, was Gott verheißen hat: „Siehe, ich mache alles neu.“
Von daher muss ich gestehen, dass ich lieber einen anderen Vers als Jahreslosung gehabt hätte – einen ohne den apokalyptischen Hintergrund. Und es gibt ja einen anderen, in dem es auch darum geht, dass Gott Neues schafft, ein Wort das Mut, Trost und Hoffnung für mich sogar viel besser schenkt, als der Vers aus der Offenbarung. (Johannes hat ihn sicher gekannt.) Ich lese uns die Verse 18-19 aus dem 43.Kapitel des Propheten Jesaja:
„Denkt nicht mehr an das, was früher geschah. Beschäftigt euch nicht mit der Vergangenheit. Schaut her, ich schaffe Neues! Es beginnt schon zu sprießen – merkt ihr es denn nicht? Ich lege einen Weg durch die Wüste an, im trockenen Land lasse ich Ströme fließen.“
„Schaut her, ich schaffe Neues! Es beginnt schon zu sprießen – merkt ihr es denn nicht?“
Es ist das Wie, indem sich Jesaja von Johannes deutlich unterscheidet. Bei beiden ist Gott am Werk – er schafft Neues. Aber während Johannes die Gegenwart nur schwarz malt, sodass Gott die ganze Schöpfung der Vernichtung anheimgibt (wie zur Zeit Noahs) und dann wie ein großer Zauberer eine neue Erde und einen neuen Himmel hervorkommen lässt, sieht Jesaja Gottes schöpferisches Handeln ganz anders. Er sieht Neues schon im hier und heute. Dabei verklärt er die Gegenwart nicht: sie ist für ihn keine blühende Landschaft, sondern Wüste. Das Neue ist keine üppige Oase, die – schwupp – einfach mal so da ist. Nein, unter den Steinen, in den Felsritzen, unter dem Dornengestrüpp, da regt sich Leben, da sprießt etwas. Da grünt es – zart, verletzlich – aber es grünt. Die Hoffnung auf neues Leben mitten in der Wüste – sie ist da, sie lebt auf. Und damit wird ein Weg möglich – durch die Wüste, mitten durch; und – der Hörer zur Zeit des Jesaja weiß: mitten in der Wüste, in der schier endlosen Trockenheit, da füllt strömender Regen immer wieder die trockenen Wadis und lebendige Wasser schaffen Lebensräume in einer sonst wie tot daliegenden Welt. Die Wüste, die Trockenheit, das Lebens-Bedrohliche, all das, was dem Leben und der Freude entgegensteht – die werden von Gott nicht „abgeschafft“, sondern sein Lebensatem schafft mitten drin Neues. Neues Leben. Neue Lebensmöglichkeiten. Und das nicht „am Ende der Tage“, sondern hier und heute.
„Merkt ihr’s denn nicht?“ „Seht ihr es denn nicht?“
Darauf kommt es Jesaja, kommt es Gott an: dass wir genau hinsehen. Weder die Augen verschließen vor all den lebensfeindlichen Wüsten unserer Zeit, vor all den Gefahren von rechts und links, vor all den Problemen in unserer Gesellschaft, in unseren Kirchen, in der globalen Politik mit allen Kriegen und Konflikten. Wegsehen hilft nicht, sich eine Cyber-Brille aufzusetzen noch viel weniger. Nein: schaut die Wirklichkeit genau an und seht, wo sich überall Gutes, Lebensförderliches, einem gerechten Miteinander aller Völker und Menschen zuarbeitendes Handeln finden lässt – und das gibt es überall zu finden! Nachbarschaftliche Hilfestellungen, Repaircafés, „Omas gegen rechts“, die auf die Straße gehen, „Fridays for Future“ - junge Menschen, die sich engagieren, so viele NGOs wie „Brot für die Welt“ und „Misereor“, „Ärzte ohne Grenzen“, die Bewegung „Taxe us now“, die eine gerechte Besteuerung hoher Vermögen und Einkommen fordert. „Merkt und seht ihr’s denn nicht?“
Das Neue schafft Gott durch Menschen, die sich von ihm einen neuen Geist und ein neues Herz haben schenken lassen.
Durch Menschen die ihrerseits an dem Zustand der Welt, wie sie jetzt ist, leiden wie Gott; weil sie die Welt-Liebe Gottes teilen. Weil sie sehen, wo überall die Menschen und die ganze Schöpfung seufzen und sich danach sehnen, dass es friedlicher, gerechter, mitfühlender und barmherziger auf Erden zugehen soll.
Ja, alles soll neu werden, und alles kann und wird neu werden - wie es in der Jahreslosung heißt. Gottes Kreativität kennt keine Grenzen; sein Zutrauen in seine Menschenkinder auch nicht – trotz vieler Enttäuschungen, die wir ihm durch die Zeiten bereitet haben. Er zählt darauf, dass wir umsetzen, was sein Geist uns vermittelt. Das betrifft alle Lebensbereiche. Alles soll neu, soll anders werden. Und das global. Das Wirtschaftsleben, die Finanzwelt, die gesellschaftlichen und politischen Ordnungen und Einflusssphären, die Verteilung von Gütern und Macht.
Schrecken wir da zurück? Ist uns das mit dem Neumachen eine Nummer zu groß? Machen wir es uns doch lieber in unseren privaten Nischen gemütlich - Ungerechtigkeit und Elend auf der Welt sollen uns gestohlen bleiben! Was können wir kleine Nummern da schon ausrichten?
Aber nicht doch! Machen wir uns nicht kleiner als wir sind. Seit Weihnachten sind wir groß – Gott hat sich in Jesus unserer Fürsorge anvertraut. Der Apostel Paulus formuliert das in seinem Brief an die Korinther so: „Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Das alles ist von Gott.“ (2.Kor.5,17-18a) Und im Brief an die Epheser heißt es: „Lasst euch dadurch erneuern, dass Gottes Geist in eurem Verstand wirkt. Und zieht den neuen Menschen an wie ein neues Gewand. Denn er ist nach Gottes Bild geschaffen und dadurch fähig zu wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.“ (Eph.4,23-24)
Entscheidend ist, dass wir innerlich dazu bereit sind, in diesen Erneuerungsprozess einzuwilligen. Dass wir uns auf das Abenteuer Gottes, die Welt zu erneuern und zu heilen, einlassen und Ja sagen – wie Maria Ja gesagt hat und bereit war, den Ersten der neuen Schöpfung zur Welt zu bringen. Und irren wir uns nicht: Der legendäre Ausspruch Michail Gorbatschows gilt auch hier: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“
„Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu!“
„Schaut her, ich schaffe Neues! Es beginnt schon zu sprießen – merkt ihr es denn nicht?“
Die Ordnungen dieser Welt, die so viel Leid verursachen und nicht verhindern, die sehen wirklich sehr alt aus. Das Neue, das von Gott inspiriert ist, ein Leben, das die Schöpfungsordnung, die Gottes Willen entspricht, respektiert, ist schon unterwegs und sprosst auf in den Wüsten der Welt. Lassen wir uns mitnehmen und einladen, unseren Teil beizutragen.
Amen.
Neujahrstag, 01.01.2026, Off. 21,5, Tersteegenkirche, Doerthe Brandner
Seit heute begleitet uns eine neue Losung durch das Jahr. Es ist ein Vers aus der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel - Gott spricht: "Siehe, ich mache alles neu."
Der heutige Podcast aus der Tersteegenkirche umfasst den gesamten Gottesdienst, die Predigt beginnt bei 21:48.
2. Christtag, 26.12.2025, Mt 1, 18-25, Stadtkirche, Doerthe Brandner
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt.
Amen
Ein irisches Weihnachtslied (Quelle unbekannt):
Wenn der Gesang der Engel verstummt ist,
Wenn der Stern am Himmel untergegangen,
Wenn die Könige und Fürsten heimgekehrt sind,
Die Hirten mit ihren Herden fortgezogen sind,
Dann erst beginnt das Werk von Weihnachten:
Die Verlorenen finden,
Die Zerbrochenen heilen,
Den Hungernden zu essen geben,
Die Gefangenen freilassen,
Die Völker aufrichten,
Den Menschen Frieden bringen,
In den Herzen musizieren.
Noch, liebe Gemeinde, ist der Gesang der Engel nicht verstummt und die Hirten sind noch nicht wieder heimgekehrt. Noch stehen wir im Licht von Weihnachten – auch heute am 2. Weihnachtstag noch und übermorgen am Sonntag und noch bis in das neue Jahr hinein.
Doch spätestens an dem ersten Wochenende im neuen Jahr rückt der Alltag wieder in greifbare Nähe. Mancher seiner Schatten mag sogar bis heute reichen.
Dann, liebe Gemeinde, beginnt die Zeit, in der es an uns ist, das Werk von Weihnachten zu beginnen.
Das Werk von Weihnachten…
Es war in der Woche zwischen dem 3. und dem 4. Advent. Aufgebracht erzählte mir eine Frau bei unserer Begegnung von etwas, das sie furchtbar ärgerte. Und sie schloss ihren Bericht mit den Worten: Diese Person und ihr Verhalten haben mir das ganze Weihnachten verleidet!
Das ganz Weihnachten ist mir verleidet…
Die Worte klangen mir noch nach, als unser Gespräch längst beendet war. Das ganze Weihnachten…
Was diese Frau wohl damit meinte?
- Besinnlichkeit?
- Harmonie und Familienfrieden?
- Zwei bis drei Tage, in denen die Sorgen und die Schatten des Alltags draußen bleiben und einfach mal alles gut ist?
Je länger mir die Worte der Frau und ihr spürbarer resignativer Ärger nachgingen, desto ratloser wurde ich…
… das ganze Weihnachten. Das klingt so groß und umfassend. So absolut. ALLES ist verleidet – das GANZE Weihnachten…
Hatte nicht irgendjemand mal gesagt: Die Botschaft von Weihnachten ist so groß und gleichzeitig so klar und eindeutig, dass sie quasi in eine Nuss passt?
Weihnachten in nuce.
Dann ist dieses Jahr Weihnachten für meine Gesprächspartnerin wohl zu einer tauben Nuss geworden – weil jemand und etwas sie bitter geärgert hatte?
Wenn das so ist,
wenn Weihnachten so anfällig und labil sogar für kleinen, persönlichen Ärger ist, dann geht es wohl auf in Hirtenromantik, im seligen Lächeln des Kindes mit lockigem Haar und süßem Glockenklang.
Auf keinen Fall ist Weihnachten mit seiner Botschaft dann so kraft- und machtvoll, dass der Himmel auf die Erde kommt und – wie es in einem Weihnachtslied heißt: Dass Sünd und Hölle sich grämen und Tod und Teufel sich schämen (EG 39 Str. 2) – und in einem anderen die Tür zum Paradies wieder aufgeschlossen ist (EG 27, 6).
Die Weihnachtsgeschichte, in der der Evangelist Matthäus von der Geburt Jesu erzählt, gibt eine Ahnung davon, dass dieses Ereignis etwas anderes ist als Familienharmonie und als das, was viele von uns in unserem Herzensgrund für diese Tage ersehen.
Matthäus erzählt von einem Weihnachten, das die Kraft hat, Menschen dazu zu bringen, von persönlicher Kränkung abzusehen und stattdessen in den Sperrigkeiten und Widrigkeiten des Lebens, in die man selbstverursacht oder von anderen geschubst, hineingeraten ist, ein gottgewirktes Wunder zu entdecken.
Hören wir, was der Evangelist Matthäus in seinem ersten Kapitel berichtet:
Mt 1, 18-25
18Die Geburt Jesu Christi geschah aber so:
Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich,
ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist.
19Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war
und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen.
20Als er noch so dachte, siehe,
da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach:
Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist.
21Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben,
denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.
22Das ist aber alles geschehen, auf dass erfüllt würde,
was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht:
23»Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären,
und sie werden ihm den Namen Immanuel geben«,
das heißt übersetzt: Gott mit uns.
24Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er,
wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich.
25Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar;
und er gab ihm den Namen Jesus.
Die Geburt Jesu Christi geschah aber so:
So beginnt ein nüchterner Bericht – ganz anders als die: Es-war-einmal-Geschichte des Evangelisten Lukas, die sich zu der Zeit begab, als Quirinius Statthalter von Syrien war.
Und es mag sich für die eine und den anderen beim Hören anfühlen, als stolpere sie und er in ein ungeplantes Ereignis hinein, genauso wie Josef in die ungeplante und unerwartete Schwangerschaft seiner Verlobten hineinstolperte.
Und mit Josef stehen wir mit diesem Bericht des Mt vor der Frage und der Herausforderung:
- Nehmen wir Reißaus und verabschieden wir uns stiekum aus dem Geschehen wieder hinein in die Heimeligkeit unserer Weihnachtszimmer?
- Oder lassen wir uns mit dem Bericht des Mt zu einer Weihnachtserkenntnis führen, die uns ebenso – wie Josef die nicht von ihm herbeigeführte Schwangerschaft von Maria – nötigt, die Dinge, die das Leben aufgibt, in einem ganz anderen Licht zu sehen?
…
Die Dinge, die das Leben aufgibt –
Für meine Gesprächspartnerin in der vergangenen Woche war dies eine zugefügte Kränkung. In dieser Geschichte ist es, wie auch heute für unzählige Frauen hier und anderswo, eine ungeplante – oft auch ungewollte – Schwangerschaft zur Unzeit, die eine junge Frau wie Maria damals – und junge Frauen auch heute noch anderswo und auch hier – aus der sozialen Ordnung fallen lässt.
Und eigentlich denke ich, müsste nun der Evangelist Mt in seinem Bericht im vorauseilenden Gehorsam des Kindes, das als Erwachsener jeden Menschen, der ihm begegnete, ansah, nach Maria fragen – und mit ihr nach all den Marias überall auf der Welt: Du Mädchen – du Frau…
- Wie geht es dir?
- Welche Sorgen und Ängste treiben dich um?
- Wirst du dieses Kind annehmen – am besten sogar lieben können – oder wird es dir fremd bleiben – sogar eine bittere Erinnerung an die Umstände sein, durch die du schwanger geworden bist?
- Oder gibt es womöglich eine trotzige Dennoch-Freude in dir über das wachsende Leben?
…
Damit die Marias dieser Welt –
so gesehen und gefragt werden, wird dieses Kind dieser Maria geboren werden und leben.
Und vielleicht wird es Menschen ja so sehen und fragen können, weil seine Mutter in der Schwangerschaft mit ihm gelernt hat: Was auch immer die Menschen sagen mögen: Dieses Kind ist ein Gotteskind. Denn nur durch Gottes Zutun wächst es in mir.
Und die Botschaft dieses Gotteskindes an jeden Menschen wird sein:
DU bist ein Gotteskind. Aus Gottes Segen lebst du und mit Gottes Segen gehst du – immer. Gottes Segen ist stärker als alles Lebensleid und alle Kränkung.
Doch da ist der Evangelist Matthäus noch nicht.
Er überlässt es seinen Lesenden diese Schlüsse zu ziehen.
Mt rückt Josef in den Fokus.
- Und lese ich dies aus heutiger Sicht, denke ich: Ja, natürlich muss – auch – Josef in den Blick rücken, denn eine Schwangerschaft ist nie nur allein Frauensache!
Mit Matthäus ist es Josef aufgegeben, sich zu der Schwangerschaft seiner Verlobten zu verhalten – oder eher noch eine Haltung zu ihr zu finden.
Das überfordert Josef.
Aus seiner Sicht gesehen finde ich es sehr verstehbar, dass er einen Ausweg für sich sucht. Und es ist achtenswert, dass er diesen Ausweg so sucht, dass Maria als unverheiratetes schwangeres junges Mädchen damit in der damaligen Gesellschaft maximal geschützt ist.
Ihm hilft die mythologisch gefärbte Begründung, dass Maria jungfräulich schwanger geworden sei – also Gott selber durch den Heiligen Geist der Vater? – der Verursacher? – der Erzeuger? – des Kindes sei, erst einmal nicht. Das klingt in Josefs Ohren doch nach einer allzu abenteuerlichen Ausrede.
Und mal ehrlich! – Wer von uns kann schon als wacher, denkender Mensch mit Glaubensinbrunst die Worte des Apostolischen Glaubensbekenntnisses mitsprechen: Geboren von der Jungfrau Maria? – Die Konfis in meinen bisherigen rund 30 Berufsjahren sperrten sich zumindest meist heftig dagegen.
Kein Wunder, dass Josef sich davonstehlen will.
Wie viele Menschen mögen sich aus diesem Glauben und der Kirche stehlen, weil die Forderung nach einem Glauben mit Aussagen in der Qualität einer Jungfrauengeburt sich ihrem aufgeklärten Geist zu tiefst sträubt? – Aussagen, die stehen gelassen werden, statt sich an ihnen reibend sie tiefer zu durchschmecken, sodass die in ihnen liegende Wahrheit jenseits der Richtigkeit der Worte beginnt zu leuchten. –
…
Und dann träumt Josef.
Und im Traum begegnet ihm ein Engel, der das Unglaubliche bestätigt und Josef zu der Erkenntnis führt: Die Verantwortung, die ich als Verlobter habe, reicht viel weiter als nur bis zur Fürsorge für Maria.
Josefs traumhafte und engelsgewirkte Erkenntnis liegt nicht in dem Für-wahr-Halten der jungfräulichen Schwangerschaft. Sie liegt darin, Gottes Mit-dieser-Welt-Sein zu entdecken und als Aufgabe für sich selbst anzunehmen.
Der Auftrag, den der Engel Josef gibt, ist ebenso schlicht wie groß:
- Nenn das Kind bei seinem Namen und mach diesen Namen öffentlich.
Vordergründig betrachtet ein völlig folgerichtiges Verhalten, wenn ein Kind geboren ist.
In der Tradition damals aber wenigstens unerwartet, wenn nicht ein Bruch mit allem, was sich gehört: Söhne hießen nach ihren Vätern und Vorvätern. Denn in der eigenen Familie findet man seine Wurzeln, seine Herkunft und Zugehörigkeit.
Jesus – Jeshua – diesen Namen gab es in dem Stammbaum Josefs nicht, wie in den Versen vor diesem Bericht deutlich wird.
Unerhört ist deshalb der Name, den Josef dem Kind geben soll.
Ungehörig – und unerhört, denn die im Namen liegende Botschaft ist offenbar lange nicht mehr gehört worden:
Gott mit uns – Immanuel
Und mit dieser Namensgebung erfolgt ein Perspektivwechsel, der radikaler nicht sein könnte:
Was wir sehen und wie wir die Wirklichkeit benennen, zeugt von unserer Wahrnehmung und unserem Er-Leben.
Wenn wir es schaffen von unserer Wahrnehmung abzusehen und den Raum unserer eigenen – freiwilligen oder unfreiwilligen – Verstricktheit in die Dinge der Welt zu verlassen, öffnet sich uns der Blick hin zum wahren Wesen dieser Welt, das jenseits unserer Verfügbarkeit liegt.
In diesem Bericht von der Geburt Jesu erhält Josef genau diese Aufgabe: Den Sprung aus dem Gefangensein in persönlicher Kränkung und eigener Weltsicht zu wagen – sich loszulassen und die eigene Wirklichkeit zu verlassen – hinein in den Segen dessen, der vor allem Anfang war – der schöpfungsgleich die Welt durchwirkt – und der nach allem Ende immer noch sein wird.
- Den Segen, der heißt: Gott mit uns – Immanuel.
Das ist die Botschaft des Mt.
Mit Josef wird Weihnachten zum Ruf an uns, unsere Wirklichkeit bei dem Namen zu nennen, den sie von Gott her hat:
- Immanuel – Gott mit dir und mir, wenn wir gefangen sind in den Kränkungen, die uns das Leben zufügt.
- Genauso, wenn wir in unserem eigenen Kleingeist verharren,
wie wenn die frisch erfahrene Kränkung an einen viel früheren und tiefer liegenden Seelenschmerz rührt.
Immanuel, Gott mit uns –
- Gott mit all den Frauen, die schwanger sind, und die Angst haben, dass sie mit ihrer Schwangerschaft nicht akzeptiert werden und ihrem Kind schon jetzt der Platz im Leben verwehrt wird. – Und mit allen Männern, die vor ihrer Verantwortung fliehen wollen.
Immanuel, Gott mit uns –
- Gott in unserer Welt überall dort, wo wir ob der Brüchigkeit und Gebrochenheit unseres Daseins an unsere Grenzen geraten.
Immanuel, Gott mit uns –
- Gott in unserer ganzen Welt – hier bei uns: auf Parkbänken und in Odachlosenunterkünften, auf Säuglingsstationen, Babyklappen und in Wohnheimen für jugendliche Mütter und ihre Kinder. Und überall – in der Ukraine und in Palästina, im Sudan und in Venezuela – ach die Liste ließe sich endlos fortsetzen und jede, jeder hier mag ergänzen, was und wer ihr, was ihm am Herzen liegt... jetzt in er Stille
- Stille
Immanuel, Gott mit uns –
Mit seiner Geburt schreibt Gott sich die Brüche, die Seelennot und das Leid jedweder Art in den eignen Leib.
Mit seinem Leben wird er seinen Gott-mit-uns-Weg weitergehen.
Mit seinem Tod wird er ihn bis zur Neige auskosten.
In gut drei Monaten werden wir schon wieder Jesu Tränen von Gethsemane sehen und unter seinem Kreuz stehen – und an Ostern werden wir die Erfüllung dieses Gottesweges mit uns feiern.
Deshalb:
Immanuel, Gott mit uns – mit seiner Welt, in all ihrer Weinen machenden Schönheit und in all ihrer sogar Klagen zum Verstummen bringenden Dunkelheit.
Das ist die Botschaft von Weihnachten, die so groß und einfach ist, dass sie in eine Nuss passt.
Mit ihr beginnt das Werk von Weihnachten, das wir mit Gottes Hilfe weiterführen und durch das neue Jahr tragen werden.
Dazu segnet uns Immanuel – Gott mit uns.
Amen.
Kanzelsegen:
Und der Friede des Gottes-mit-uns,
der uns im Kind in der Krippe entgegenkommt,
der uns in Jesus von Nazareth begleitet,
der unseren Unfrieden mit seinen am Kreuz geöffneten Armen empfängt,
der am Ostermorgen die gesamte Schöpfung mit Jubel erfüllt,
der bewahre eure Herzen, Sinne und eueren Leib in der Gegenwart Jesu Christi.
Amen
Veranstaltungskalender
Gemeindebüros

Adresse
Fliednerstr. 6
40489 Düsseldorf
Tel.: 0211 40 12 54
Adresse
Tersteegenplatz 1
40474 Düsseldorf
Tel.: 0211 43 41 66
Öffnungszeiten
| Mo - Fr | 09:00 - 15:00 Uhr |
| Di | 09:00 - 18:00 Uhr |
Öffnungszeiten
| Di | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Mi u. Fr | 09:00 - 12:00 Uhr |
Spendenkonto
Ev. Kirchengemeinde Kaiserswerth-Tersteegen
DE38 3506 0190 1088 5230 39
.
Tageslosungen
Psalm 119,41
Es kam eine Furcht über sie alle, und sie redeten miteinander und sprachen: Was ist das für ein Wort? Jesus gebietet mit Vollmacht und Gewalt den unreinen Geistern, und sie fahren aus.
Lukas 4,36




